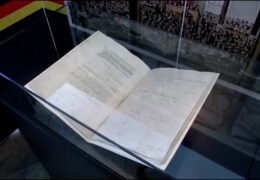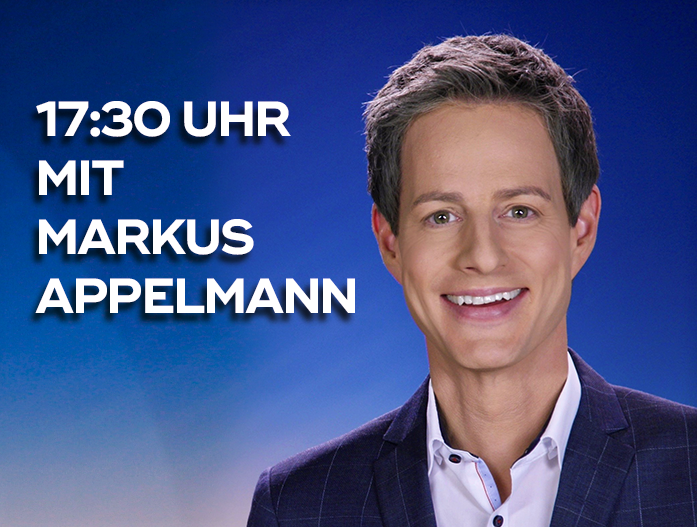Cannabis-Legalisierung in Kraft
Kaum ein Thema ist so hoch umstritten – das Cannabisgesetz drohte auf den letzten Metern noch zu scheitern oder sich zumindest zu verzögern – jetzt ist es doch da. Seit gestern sind der Besitz und Anbau der Droge in begrenzter Menge in Deutschland erlaubt, ab Juli gehen sogenannte Cannabis-Clubs an den Start. In vielen Städten in Hessen und Rheinland-Pfalz sind gestern die ersten Kiffer ganz öffentlich zum gemeinsamen Rauchen zusammengekommen. Ankiffen vor dem hessischen Landtag gestern Abend. Vor kurzem noch ziemlich riskant, jetzt legal. Hier in der Fußgängerzone gilt das nach 20 Uhr. Mario kämpft schon lange für die Legalisierung, startete mehrere Petitionen. Für ihn bedeutet der Tag heute endlich ein Ende der Stigmatisierung. Mario B. „Auf jeden Fall ist es jetzt definitiv entkriminalisiert und das ist natürlich ein wichtiger Schritt, denn vorher war ja auch das Kiffen eigentlich erlaubt, aber zugleich durftest du nichts besitzen.“ Trotzdem wollen die meisten hier noch unerkannt bleiben. In der Öffentlichkeit dürfen Erwachsene ab 18 Jahren bis zu 25 Gramm Cannabis mit sich führen. Der Konsum ist nur mit einem Mindestabstand von 100 Metern zu Schulen, Kitas und Spielplätzen erlaubt. Für Jugendliche bleibt Cannabis verboten. Bis zur letzten Sekunde wollten die CDU-geführten Bundesländer das Cannabisgesetz verhindern und übten massive Kritik. Zwischen Beschluss im Bundestag und Inkrafttreten sei für die Behörden zu wenig Vorbereitungszeit gewesen. Nur ein Gegenargument von vielen, sagt heute auch Christian Baldauf von der rheinland-pfälzischen CDU. Christian Baldauf (CDU), Landesvorsitzender Rheinland-Pfalz „Es ist ein Riesenfehler, es bringt enormen zusätzlichen Aufwand für Polizei und Justiz und ist im Übrigen auch gesundheitsschädlich, wie viele Mediziner dies sagen. Ein Gesetz, das wirklich kein Mensch verstehen kann.“ In Wiesbaden sind die Passanten geteilter Meinung. Peter Sander „Mich stört das nicht, ich finde das eigentlich gut, dass die Legalisierung jetzt da ist, nur die Umsetzung der Regelkontrollen, […]