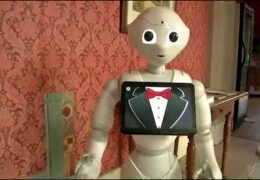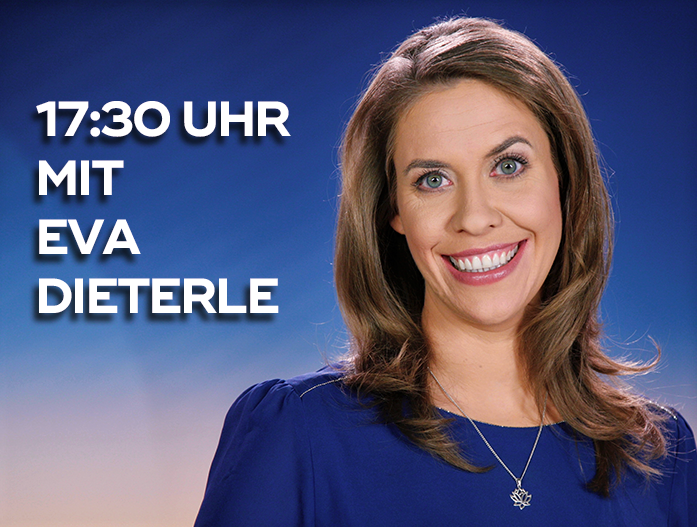Festival in Wiesbaden widmet sich mittel- und osteuropäischen Filmen
Der Krieg in der Ukraine – er spielt eine wichtige Rolle beim Filmfestival goEast. Wie der Name schon sagt, nehmen die Filmschaffenden, die sich gerade wieder in Wiesbaden treffen, Mittel- und Osteuropa in den Blick. Wie in dieser sehr persönliche Dokumentation über eine durch den Krieg getrennte Familie. Die Nacht in der Russland die Ukraine angreift. Olga Chernykh verbringt sie bei ihrer Mutter, die im Leichenschauhaus arbeitet, abgeschnitten von ihrer Großmutter, im Osten des Landes. Filmausschnitt Die Regisseurin zeichnet das Bild ihrer Familie, die versucht mit dem Krieg umzugehen. Gespickt mit Erinnerungen an die Heimat Donezk, festgehalten in selbstgedrehten Videoaufnahmen. „Ein Thema, an das jeder mit seiner eigenen Familiengeschichte anknüpfen kann“, sagt die Regisseurin bei der Deutschlandpremiere in Wiesbaden. Olga Chernykh, Regisseurin „Ein Foto zum Andenken“ „Was die Erinnerung betrifft, da denke ich, dass es etwas ist, was wir alle haben und das wir alle sammeln können, wenn wir etwas aus unserer Vergangenheit oder aus unserem Familienerbe verloren haben. Und diese Schätze können uns in manchen Momenten des Lebens wirklich helfen, wenn wir uns im Leben verlieren.“ Ein Schatz. der auch Olga Chernykh hilft damit umzugehen. Ihre Großmutter erzählt ihr per Telefon von früher aber auch von ihren Kriegserlebnissen. Filmausschnitt Das Publikum ist begeistert. Yulia Panas-Popyk „Ich selbst bin im März 2022 aus Kiew gekommen und dieser Film erinnert mich wirklich an das, was wir durchgemacht haben. Wir sind in der Nacht auch wegen der Explosionen aufgewacht.“ Anna Kayumowa „Es hat mir echt das Gefühl gegeben, dass ich diese Familie beobachtet habe.“ Thomas Wunsch „Ich bin seit vielen Jahren hier auf dem Filmfestival und man sieht hier eine ganz andere Art von Sichtweise von den Filmemachern, von den Geschichten, die erzählt werden.“ Einer von insgesamt 91 Kurz- und Langfilmen bei Deutschlands größtem Filmfestival für Mittel- und Osteuropa. Sie zeigen den […]