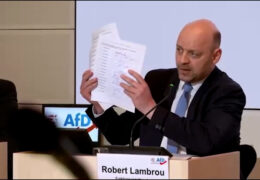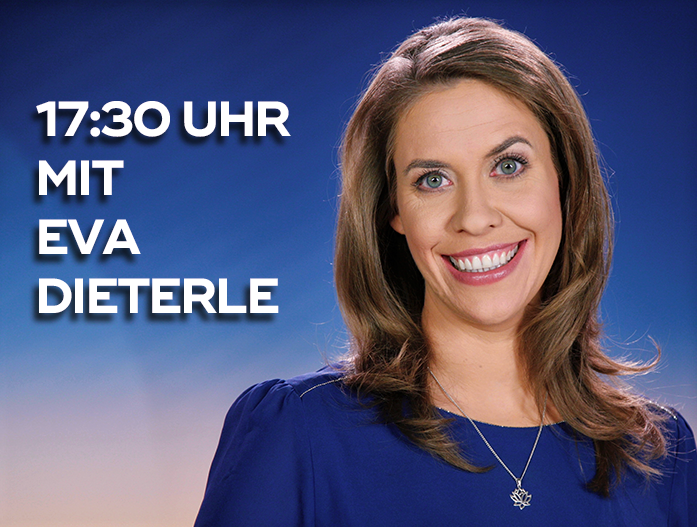Hessische Landesregierung zieht 100-Tage-Bilanz
100 Tage – so lange regiert Schwarz-Rot in Hessen. Genau die richtige Zeit eine erste Bilanz zu ziehen. Wenn man das Ergebnis einer aktuellen Umfrage nimmt, muss man davon ausgehen, dass die Bürger einigermaßen zufrieden sind mit der Leistung der Regierung aus CDU und SPD. Denn wenn am Sonntag in Hessen Landtagswahl wäre, würde die CDU 37 % der Stimmen erhalten. Das wären 2,4 Prozentpunkte mehr als bei der Landtagswahl. Die AfD würde 2,4 Prozentpunkte verlieren, bliebe aber mit 16 % die zweitstärkste Kraft. SPD und Grüne erhielten jeweils 15 %, die FDP 5 % der Stimmen. Die Umfrage zeigt: Die Regierungskoalition aus SPD und CDU hätte wieder eine Mehrheit. Eine erfreuliche Nachricht für die hessische Landesregierung, die heute ihre traditionelle Zwischenbilanz nach 100 Tagen im Amt gezogen hat. Äußerst harmonisch präsentieren sich Ministerpräsident Boris Rhein und sein Vize Kaweh Mansoori heute zur 100-Tage-Bilanz in der hessischen Staatskanzlei. Die Koalitionäre aus CDU und SPD zeigen sich zufrieden mit dem Regierungsstart. Kaweh Mansoori (SPD), Wirtschaftsminister Hessen „Unser Ansatz ist zügig, zukunftsorientiert und zugewandt. Wir haben in den ersten 100 Tagen für die Menschen in Hessen Wichtiges auf den Weg gebracht.“ Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident Hessen „Wir haben insoweit seit dem 18. Januar einen echten Kickstart hingelegt.“ Mehr als 80 Vorhaben seien auf den Weg gebracht worden. Darunter auch alle Punkte aus dem Sofortprogramm. Der kostenlose Meisterbrief, der den Fachkräftemangel im Handwerk bekämpfen soll, eine Offensive gegen Kriminalität in Innenstädten mit zahlreichen Razzien im Frankfurter Bahnhofsviertel, eine zusätzliche Deutschstunde an Grundschule sowie das neue Hessengeld. Damit sollen insbesondere Familien beim Kauf des Eigenheims finanziell unterstützt werden. Kaweh Mansoori (SPD), Wirtschaftsminister Hessen „Wir gehen seit dem 18. Januar die Alltagsprobleme der Menschen an. Das beginnt bei der Bekämpfung des Fachkräftemangels und das geht weiter bei den Bildungchancen. Insofern freue ich mich natürlich, dass […]