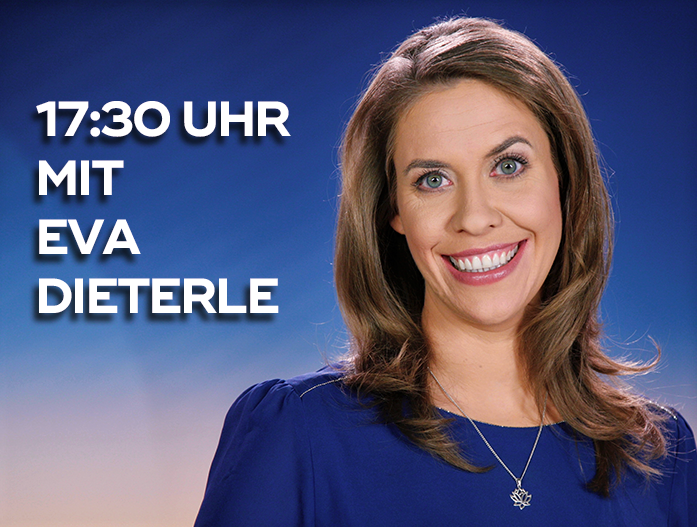Sturm richtet Schäden an
Vor allem in Hessen hat der Frühjahrssturm seine Spuren hinterlassen. Bei Alsfeld verletzen sich zwei Autoinsassen, als sie in einen umgestürzten Baum krachen. Am Frankfurter Hauptbahnhof ging zeitweise nichts mehr. Und das Unwetter hat weitere Schäden angerichtet. Es sind Bilder der Verwüstung: Im südhessischen Ober-Ramstadt wird das Dach eines Mehrfamilienhauses fast komplett abgerissen. Die Feuerwehr und das technische Hilfswerk müssen die Überreste sichern, damit keine Teile auf eine benachbarte Schule stürzen. Verletzt wird zum Glück niemand. Frank Nitzsche, Stadtbrandinspektor Ober-Ramstadt „Die Lage auf Anfahrt war, dass wir gesehen haben, dass das Dach sich im Prinzip nach oben geklappt hatte, große Teile der Dachisolierung bereits auf der Straße gelegen haben und Bewohner das Gebäude bereits verlassen hatten.“ Glück auch für die Menschen in Schwalbach am Taunus, als zeitgleich eine Tennishalle teilweise einstürzt. Der Sturm reißt einen Teil des Daches und eine Außenwand heraus. Auf den Tennisplätzen befanden sich just in diesem Moment keine Spieler, da gerade eine kurze Pause zwischen zwei Matches war. Joachim Benner, Zugführer Feuerwehr Schwalbach „Die Personen, die in der Halle waren, haben geistesgegenwärtig die Halle verlassen, waren zum Glück schon außerhalb des Gebäudes. Es hatte hier diese Verkleidungsteile aus der Halle durch den Wind herausgedrückt.“ Die Tennishalle darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. In Ober-Ramstadt konnten die Bewohner des Mehrfamilienhauses übergangsweise bei Bekannten und in einer Pension untergebracht werden. Wann sie ihr Zuhause wieder beziehen können, ist noch nicht klar.