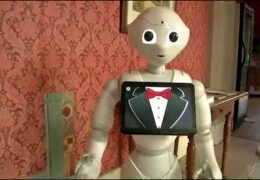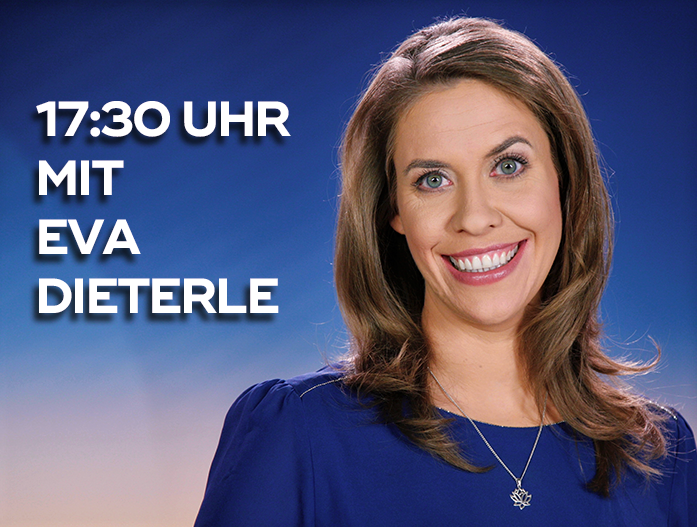Weltkriegsbombe in Mainz entschärft
Zwischen dem Mainzer Stadion und dem Europakreisel sollen viele Unternehmen der Biotech-Branche angesiedelt werden – ein Biotechnologie-Campus soll entstehen. Diese Zukunftsvision wurde von der Vergangenheit eingeholt: Bauarbeiter sind diese Woche auf eine 500 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Tausende Mainzer mussten heute ihre Wohnungen verlassen. „Guten Morgen, Sie müssen das Haus verlassen. Jetzt. Seit zehn ist hier Feierabend. Packen Sie die Sachen ein und gehen Sie jetzt.“ Nicht jeder Einwohner hatte vorab von der Bombenentschärfung gehört; Polizei und Feuerwehr durchkämmen den betroffenen Stadtteil Hartenberg/Münchfeld heute Morgen; bringen sie aus der Sperrzone. Die Einsatzkräfte evakuieren im Umkreis von 750 Metern um die Bombe; insgesamt 3500 Mainzer sind betroffen. Die meisten nehmen es locker. Niko Wolf „Die Notwendigkeit ist da. Es muss ja entschärft werden. Über den Radius kann man streiten, aber ich hab da kein Problem mit.“ Jakob Riesterer, Medizinstudent „Ich bin davon jetzt nicht so berührt. Großen und Ganzen muss es gemacht werden, da kann man nix machen.“ Inge Thielke „Deswegen habe ich beschlossen, ich fahre jetzt in die Stadt und gehe schön frühstücken.“ Auch ein Hubschrauber überfliegt die betroffenen Stadtteile, um nach Menschen Ausschau zu halten – doch kurz vor 12 Uhr sind die Straßen und Balkone wie leergefegt. Die amerikanische 500-Kilo-Bombe ist eine der größeren Bomben, die selten im Boden gefunden werden: Sollte der Kampfmittelräumdienst scheitern, könnten Splitter der Bombe zu schnellen, tödlichen Geschossen werden, auch in großer Entfernung. Doch nach einer Stunde die Entwarnung: Der Kampfmittelräumdienst hat die Bombe erfolgreich entschärft. Eine Arbeit, die nie Alltag wird. Alexander Schäfer, Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz „Alltag wird es nicht, Routine darf es auch nicht werden. Jede Situation ist anders, aber Routine sollte man da nicht aufkommen lassen, das ist ein scharfer Sprengkörper, der tötet.“ Es wird nicht der letzte Sprengkörper gewesen sein, den Alexander Schäfer und sein Team […]