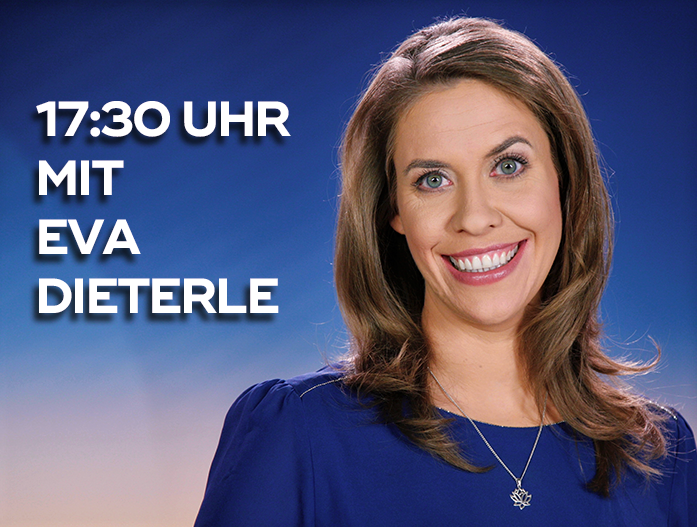Innenminister präsentiert E-Autos als Streifenwagen
Bis 2040 will Rheinland-Pfalz klimaneutral werden. Dafür müssen Treibhausgase an allen Ecken und Enden eingespart werden. Das soll unter anderem durch Elektromobilität gelingen. Rheinland-Pfalz testet nun, ob Elektroautos auch als Dienstfahrzeuge für die Polizei taugen. Die Vorbehalte sind derzeit noch groß, denn gerade bei Verfolgungsjagden könnten die geringen Reichweiten ein Problem sein. Startschuss für das E-Polizeiauto-Projekt war heute im pfälzischen Landau. Innovativ, sportlich, nachhaltig. So beschreiben Jannis Rogge und seine Kollegin Lena Böcker ihr neues Gefährt. Streifendienst im Elektroauto, gewöhnungsbedürftig für den ein oder anderen. Lena Böcker, Polizeikommissarin Polizeiinspektion Landau „Wenn was Neues kommt, ist es immer erst mal ungewohnt für alle Kollegen. Aber nach den ersten Fahrten kamen tatsächlich durchweg positive Rückmeldungen von allen Kollegen, die vielleicht auch tatsächlich skeptisch waren. Von dem her würde ich sagen, hat man den ersten Eindruck aus dem Weg geräumt und geht jetzt positiver Dinge an die Sache ran.“ Die größte Sorge: Haben die Autos genug Reichweite? Denn zu spät zum Einsatz kommen, weil das Auto noch lädt, ist keine Option. Jannis Rogge, Polizeioberkommissar Polizeiinspektion Landau „Der Hersteller hat ja gesagt, es sind 500 Kilometer Reichweite. Aber wir fahren ja trotzdem nur in Landau rum oder im äußeren Bereich. Das heißt, wir haben so ungefähr knapp an die 100 Kilometer, was man pro Schicht ungefähr fährt.“ Im Rahmen eines Pilotprojektes stehen der rheinland-pfälzischen Polizei jetzt vier E-Autos zur Verfügung. Eingesetzt werden sie zunächst für ein Jahr an den Dienststellen in Landau, Landstuhl und Trier. Warum genau hier? Michael Ebling (SPD), Innenminister Rheinland-Pfalz „Wir wollen städtische Räume genauso testen wie ländliche Räume, sprich: kurze oder weite Entfernungen. Und wir brauchen natürlich auch eine gute Ladeinfrastruktur für die Umgebung. Und letzteres war auch mit der ausschlaggebende Punkt für die Entscheidung der genannten Dienststellen. Denn ein solches Fahrzeug muss ja gegebenenfalls nicht nur auf dem Hof, […]