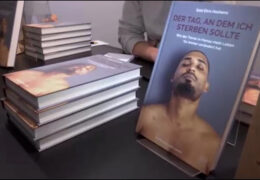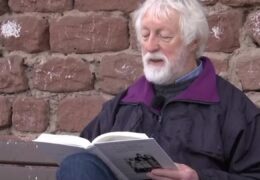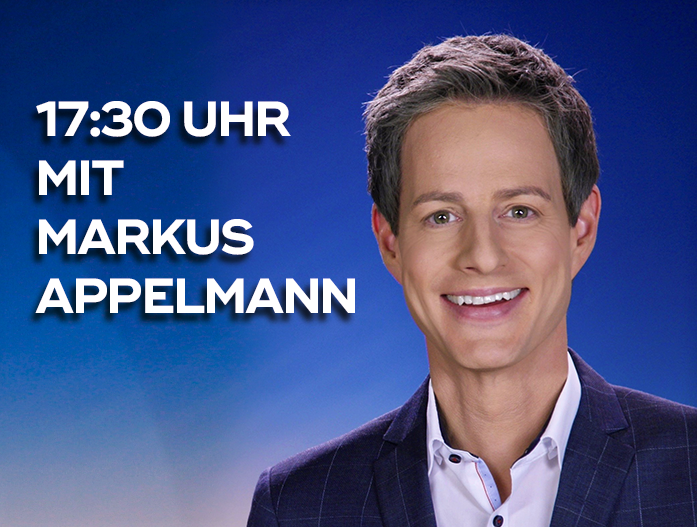Landtag debattiert über wehrhafte Demokratie
Seit Wochen gehen in ganz Deutschland Hundertausende Menschen auf die Straßen, um für Demokratie zu demonstrieren. Sie reagieren damit auf ein Treffen von AfD-Mitgliedern mit Vertretern rechtsextremer Kreise in Potsdam, bei dem im November über die Ausweisung von Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund diskutiert worden sein soll. Jetzt ist der Protest quasi von der Straße zurück ins Parlament geschwappt: In einer hitzigen Debatte im hessischen Landtag haben sich heute alle Parteien mit Ausnahme der AfD zusammengetan, um gemeinsam Flagge zu zeigen. Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident Hessen „Wir können stolz darauf sein, dass die Mehrheit der lauten Minderheit jetzt Grenzen aufzeigt. Bis hierher und nicht weiter. Das müssen Sie wissen: Bis hierher und nicht weiter zeigt die Mehrheit jetzt der lauten Minderheit auf. Und ich halte das für exakt die richtige Entscheidung.“ So lebhaft wie heute ging es im Plenum des hessischen Landtags schon lange nicht mehr zu: In einem gemeinsamen Antrag sprechen sich alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD dafür aus, allen Anti-Demokraten im Land die rote Karte zu zeigen. Und Sie meinen damit ganz ausdrücklich auch die AfD. Die wiederum sieht sich als Opfer einer Verschwörung. Die Berichte über das Treffen von Potsdam: reichlich übertrieben oder gar frei erfunden. Die Demonstrationen der vergangenen Wochen: eine einzige große Inszenierung der etablierten Parteien, um der Alternative für Deutschland zu schaden. Andreas Lichert (AfD), Landesvorsitzender Hessen „Weil Sie nicht zugeben können, dass damit ganz klar ist, dass die AfD Takt- und Impulsgeber migrationspolitischer Debatten ist. Deswegen wird diese atemberaubende Fake-News-Kampagne durchs Land getrieben.“ Für Mathias Wagner von den Grünen zeigen die vielen Großdemonstrationen der vergangenen Wochen vor allem eines ganz deutlich: Die Stimme der AfD sei eben nicht die Stimme des Volkes, wie die Partei immer wieder behaupte. Mathias Wagner (Bündnis 90 / Grüne), Fraktionsvorsitzender Landtag Hessen „Alle, die behaupten, sie würden diesen […]