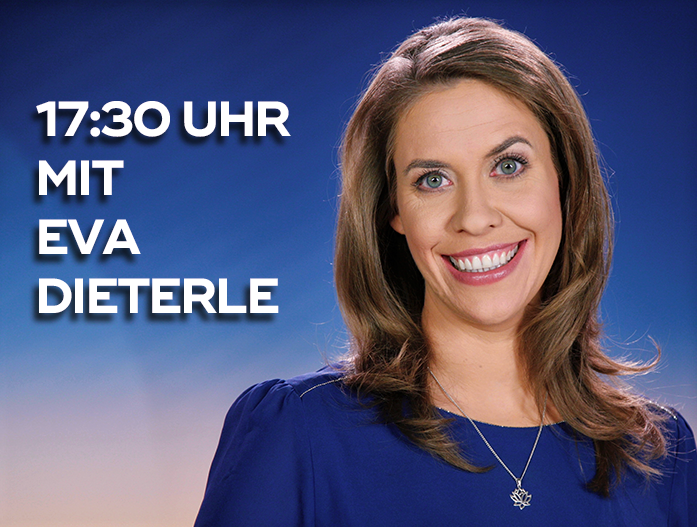Wintersport in Bad Marienberg
In den letzten Tagen haben wir bei uns die schöne Seite des Winters kennengelernt. Kalte Temperaturen, ja, dazu aber viel Sonnenschein. Nur eines hat gefehlt: der Schnee. Kein Problem für die Pistenmacher in Bad Marienberg im Westerwald – sie haben mit etwas Kunstschnee nachgeholfen. Und so steht dem Wintersportvergnügen nichts mehr im Weg. Denn seit heute Nachmittag ist der Skilift endlich wieder in Betrieb. Einen nach dem anderen schleppt der Skilift auf den Schorrberg. Und dann geht’s bergab, ob mit Ski oder Snowboard. Die Wintersportler haben zwei Pisten zur Auswahl: Familienpiste oder Steilhang, je nach Lust und Können. Alexander Salheiser, Snowboarder aus Siershahn „Es ist dieses Jahr das erste Mal, dass wir jetzt hier sind, gab ja nicht so viele Tage. Und es fühlt sich wieder gut an. Die Piste ist ein bisschen eisig durch den Kunstschnee, aber es macht wieder Spaß.“ Julia Salzmann, Skifahrerin aus Bad Marienberg „Hauptsache, hier ist beschneit worden und wir können Ski fahren.“ Michael Willwacher, Skifahrer aus Hof (Westerwald) „Es macht immer noch Spaß, aber mit normalem Schnee macht’s mehr Spaß. Und bei besserem Wetter, ist ja recht bewölkt.“ Weil es in den vergangenen Tagen zwar sehr kalt war, aber kaum geschneit hat, hat sich der örtliche Skiclub dafür entschieden, den Schnee künstlich zu erzeugen. Zehn Schneekanonen haben den Hang in ein weißes Band verwandelt. Das braucht viel Wasser und Energie. Aber ist das in Zeiten der Klimakrise noch vertretbar? Marco Stalp, Vorsitzender Skiclub Bad Marienberg-Unnau „Wir haben uns die Frage auch gestellt, aber wir sind der Auffassung, dass das auf jeden Fall vertretbar ist, weil es ja nur ein bis zwei Mal im Jahr vorkommt. Und wenn man sieht, was andernorts an Energie verpulvert wird, will ich mal sagen, dann halten wir das auf jeden Fall hier für vertretbar.“ Mitglieder des Skiclubs Bad Marienberg-Unnau […]