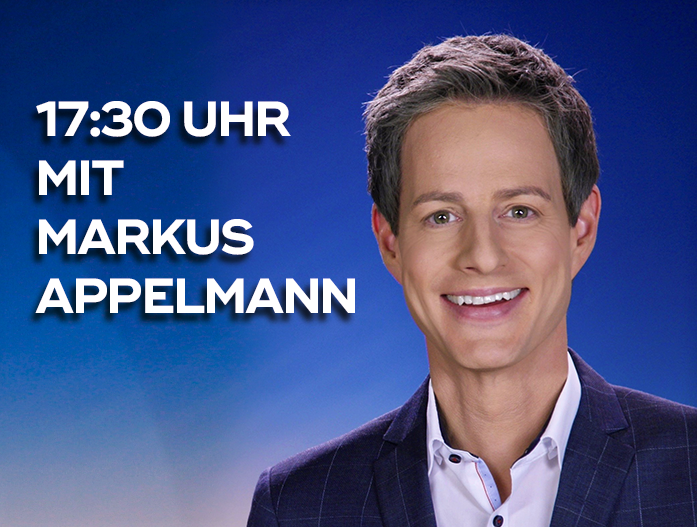Bundeswehrübung im Vogelsbergkreis
Die Älteren unter Ihnen werde sich vielleicht noch erinnern – früher waren sie ein gewohntes Bild: Bundeswehrkolonnen auf unseren Straßen. Heute zählen große Militärübungen in der Öffentlichkeit zu den eher seltenen Ereignissen. So auch in den letzten Tagen im hessischen Vogelsbergkreis. Seit Anfang der Woche läuft dort im Schlitzer Land eine große Bundeswehrübung. Mit über 230 Soldaten und schwerem Gerät. “Brückenschlag über die Fulda”, so lautet das heutige Manöver. Um den an dieser Stelle 30 Meter breiten Fluss zu überqueren, bauen die Soldaten eine sogenannte Faltfestbrücke auf. Die kann jedes der teils über 100 Tonnen schweren Bundeswehrfahrzeuge tragen. Major Rommelfanger, Panzerpionierbataillon 1 Holzminden „Und jetzt haben wir Anmarschweg und auch den Abmarschweg mit einer Faltstraße befestigt, damit die Fahrzeige sich nicht in den Boden eingraben und dann eben vor der Brücke stehenbleiben.“ Wenig später rollen die gepanzerten Transportfahrzeuge über die Aushilfsbrücke. Rund 230 Soldaten nehmen mit über 70 Fahrzeugen an der Übung teil. Sie dient der Vorbereitung für einen über 1.000 Kilometer langen Marsch im kommenden Jahr. Major Mühling, Jägerbataillon 1 Schwarzenborn „Wir werden nächstes Jahr an eine großen NATO-Übung teilnehmen, genannt ‚Saber Strike‘ und werden dazu über Deutschland, Polen nach Litauen marschieren, was eine sehr große Marschleistung für uns bedeutet und das muss heute mal geübt werden.“ Wichtig bei solchen Manövern ist auch immer die Kommunikation mit den betroffenen Gemeinden wie Schlitz. Heiko Simon (CDU), Bürgermeister Schlitz „Deswegen wurde das alles im Vorfeld sehr gut abgestimmt. Wir haben teilweise Liegenschaften für die Kfz-Wartung zur Verfügung gestellt, auch Übernachtungsmöglichkeiten auf einem Campingplatz, und ich bin selbst Oberleutnant der Reserve, von daher war es mir auch ein Anliegen das alles möglich zu machen.“ Die Bundeswehrübung ist seit Tagen das Ereignis hier im Schlitzer Land. Daher auch großes Interesse an den großen Geräten. Daniela Weigert, Anwohnerin „Ist doch interessant, das mal zu […]