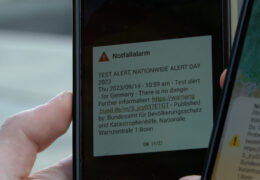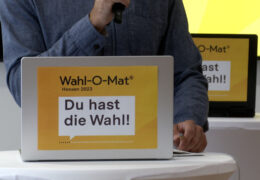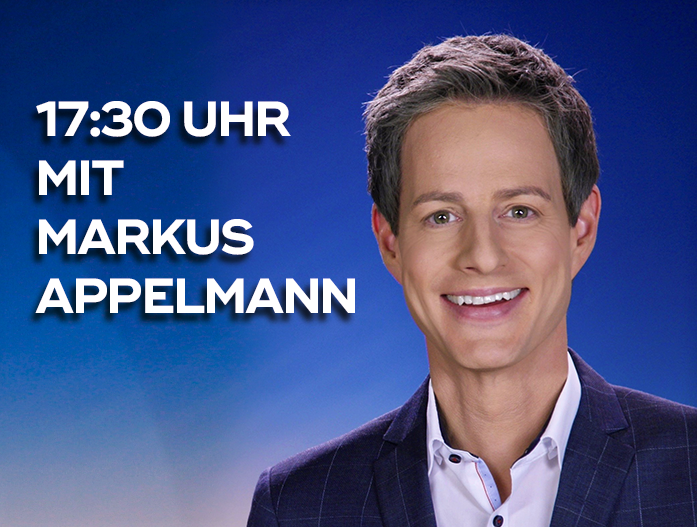Windentraining von Huschrauberpiloten
Als in der Flutnacht im Juli 2021 Menschen im Ahrtal unter anderem auf ihren Hausdächern verzweifelt auf Hilfe warteten, hofften viele auch von Hubschraubern gerettet zu werden. Doch die Maschinen der rheinland-pfälzischen Polizei hatten einen entscheidenden Mangel: Sie waren nicht mit einer Seilwinde ausgestattet. Auch als Lehre aus der Flutkatastrophe, trainiert die Polizei-Hubschrauberstaffel seit dieser Woche den Einsatz mit der Rettungswinde. Keine falschen Hoffnungen wecken. So lautete der Befehl an den Polizeihubschrauber, der in der Flutnacht über das Ahrtal flog. Der Hubschrauber sollte wieder abdrehen, weil die technische Ausrüstung zur Rettung von Menschen fehlte. Genauer gesagt eine solche Seilwinde. An ihr werden rheinland-pfälzische Polizeihubschrauberpiloten und Bordtechniker nun zum allerersten Mal ausgebildet, um ihnen zukünftig die Luftrettung zu ermöglichen. Andreas Nazarro, Chefpilot Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz „Der Kollege an der Winde, das ist wirklich eine Ausbildung, da muss man viel für machen. Zwischenwinden bedienen, über die Hand, die Kommunikation mit dem Piloten haben aber auch die Sichtzeichen zu dem Luftretter halten, also der muss wirklich Multitasking machen.“ An der Übung nehmen neben den Polizisten auch Höhenretter der Berufsfeuerwehr Koblenz teil. Eine Firma aus Bayern übernimmt die Ausbildung. Werner Greipl, Ausbilder „Es sind Stahlseil 4,83 mm zwischen Leben und nicht Leben – das verzeiht keine Fehler. Auf der technischen Seite, auf der fliegerischen Seite keine Fehler, da muss die Ausbildung sehr fundiert sein. Jeder, der damit arbeitet, muss wissen, was er tut und wie sie es tun und wie sie aus einer extremen Situation auch wieder sauber rauskommen.“ Über 300.000 Euro kostet die Windenbasisausbildung für dieses und kommendes Jahr. Gut 32 Millionen Euro gibt das Land zudem für die zwei neuen Polizeihubschrauber vom Typ Airbus H145 aus, die nächsten Sommer geliefert werden sollen. Michael Ebling (SPD), Innenminister Rheinland-Pfalz „Wir haben in der Ahrtal-Katastrophe gemerkt, dass wir dringend auch Hubschrauber brauchen, die für die Windenbergung da […]