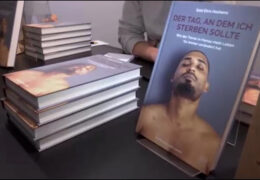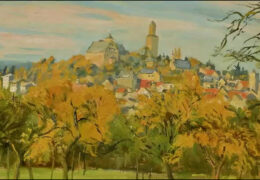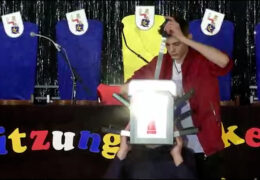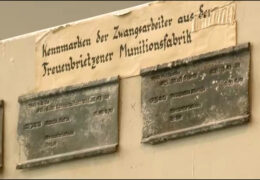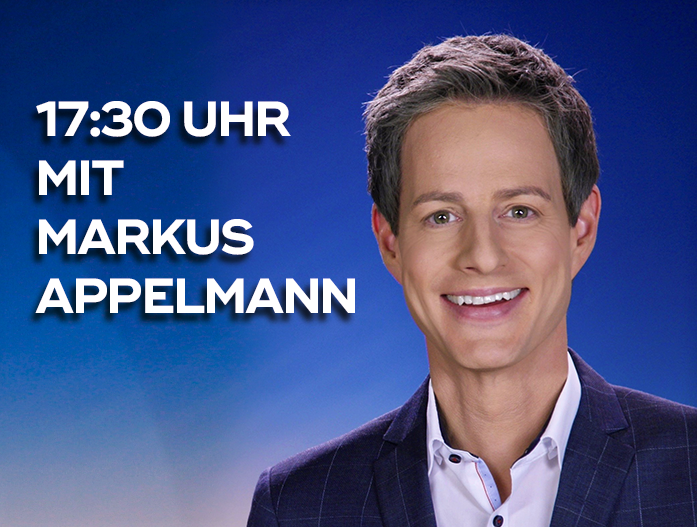Vorstellung der Motivwagen für den Rosenmontagszug
In sechs Tagen ist es wieder soweit, dann rollt der traditionelle Rosenmontagszug durch Mainz. Mehr als eine halbe Million Besucher erwarten die Veranstalter in diesem Jahr – erstmals wieder so viele Narren wie vor der Corona-Pandemie. Heute hat der Mainzer Carneval-Verein das Geheimnis gelüftet, welche Motivwagen dieses Jahr rollen. Eines vorweg: Die Themen sind so bunt und vielfältig wie die Fastnacht. Friedrich Merz hat es offensichtlich schwer, nicht über das „Brandmäuerchen“ gezogen zu werden, das ihn und seine CDU noch von der AfD und ihrem „braunen Sumpf“ trennt. „Wie wär´s mit uns?“ haben die Narren vom MCV diesen Motivwagen genannt und reimen dazu: „Komm, mein Schätzchen, her zu mir. Ich will koalieren mit dir!“ Auch in diesem Jahr nehmen die Narren wieder das politische Geschehen des vergangenen Jahres auf die Schippe. Robert Habeck fliegt das Heizungsgesetz um die Ohren, Karl Lauterbach fliegt das Gesundheitssystem um die Ohren und der Mainzer Goldesel BioNTech hat Verstopfung. Auch Sahra Wagenknecht und Alice Weidel kriegen ihr Fett weg. Sie sitzen als Barbies zwar scheinbar auf den Fahrersitzen, aber im Hintergrund lenkt Vladimir Putin. Für Michael Apitz, der wie jedes Jahr die Vorlagen für die Wagen gezeichnet hat, das Highlight der insgesamt neun Motive. Michael Apitz, Comiczeichner „Es ist schwer dieses Jahr, aber ich glaube, dass es der Wagen ist mit Alice Weidel und Sahra Wagenknecht und Putin als Barbie. Der ist so skurril und man muss wirklich zweimal hingucken, um zu wissen: Was wollt ihr eigentlich damit? Der hat so einen fiesen, tiefen Unterton und das Lachen bleibt einem im Halse stecken und ich glaube, der gefällt mir deswegen so gut, weil ich da sagen muss, die Umsetzung ist da nochmal zehnmal drüber über meiner Zeichnung. Das ist so realistisch und so schlimm und gleichzeitig schön, dass ich da sage: Der ist mein Favorit […]