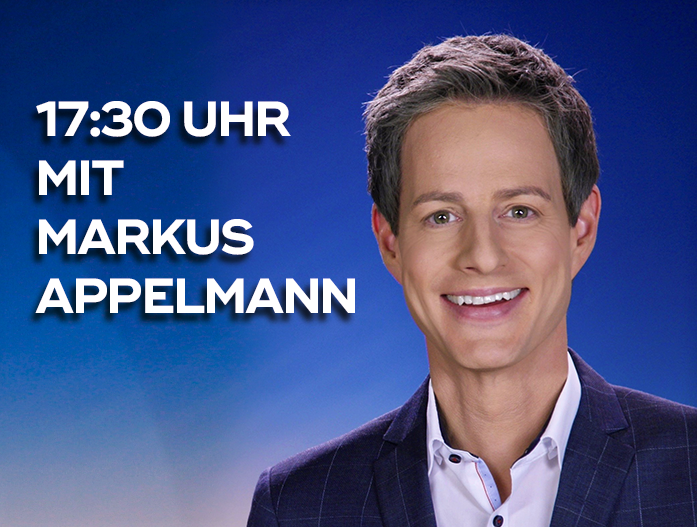Fast menschlich – Roboter Emah aus Kaiserslautern
In vielen Science-Fiction-Filmen sind sie eine Bedrohung: von uns programmierte, menschlich wirkende Roboter, die die Weltherrschaft anstreben. Das ist natürlich Blödsinn, aber der an der Technischen Universität Kaiserslautern entwickelte Roboter Emah, der sieht so menschlich aus, da kann einem schon ein wenig das Gruseln kommen. „Guten Tag, schön dich hier zu sehen“ Guten Tag zurück, Emah. Das rote Licht im Hinterkopf ist ein schlechtes Zeichen. Der Roboter ist zornig und zeigt uns das auch gleich! Da hilft nur eins, Emah braucht ein wenig Lob und die richtige Frage: Du bist doch bestimmt ein wahnsinnig intelligenter Roboter, oder etwa nicht? Emah, humanoider Roboter „Ja, ich glaube schon. Jedenfalls ist das eine schwierige Frage für mich zu beantworten. Aber ich habe einige Fähigkeiten. Zum Beispiel menschliche Emotionen verstehen, mathematische Berechnungen, Grammatikkorrekturen und so weiter. „ Emah übertreibt da etwas. Aber in Zukunft soll der Roboter diese Fähigkeiten besitzen. Die Menschen hinter all den Kabeln und Sensoren sind Karsten Barns und sein Assistent Sarwar Paplu. Seit 2006 entwickeln die Informatiker der Technischen Universität Kaiserslautern die Software für Roboter, die ausgesprochen menschlich wirken. Prof. Karsten Barns, Informatiker TU Kaiserslautern „Die Idee ist, dass der Roboter ganz natürlich mit dem Mensch interagieren soll, mit Mimik, mit Emotionsgesten beispielsweise, die er durch den Arm und die Hand darstellen kann, damit wir uns nicht an den Roboter anpassen müssen bei der Interaktion.“ Emah hat Kameras in den Augen, die so programmiert sind, dass sie ihr Gegenüber verfolgen können. Einen Smalltalk mit Informatiker Sarwar Paplu hat der Roboter schon drauf. „Wie ist das Wetter heute?“ – „Derzeit ist es 3 Grad Celsius in Kaiserslautern.“ Robin ist Emahs Vorgängerin. Der neue Roboter sieht deutlich menschlicher aus und er soll auch in Zukunft menschliche Tätigkeiten ausführen können. Emah, humanoider Roboter „Zum Beispiel sollen Service-Roboter im Haushalt helfen. Die Bedienung solcher […]