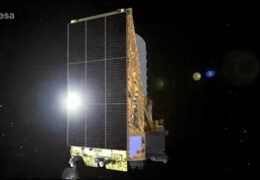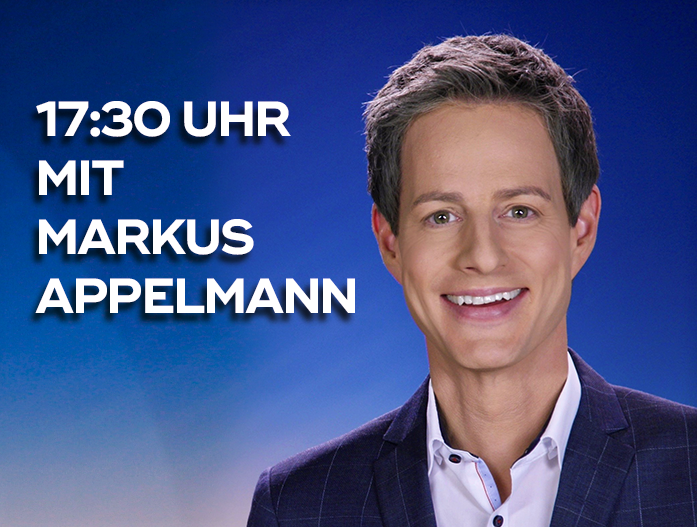Pilze als Baumaterial
Pilze sind so faszinierend wie mysteriös. Was Sie im Wald als Pilze sammeln, ist nur ein kleiner Bruchteil, denn unter der Erde haben Pilze starke Wurzen, die manchmal kilometerlang sind. Das Gute: Die Pilze wachsen in kürzester Zeit nach. Daher hat nun eine Forschungsgruppe aus Kassel ein Auge auf den Pilz geworfen: Können Pilze möglicherweise die Shootingstars der Baubranche werden? Das ist er, der Reishi-Pilz – oder auch Ganoderma genannt. Nadja Nolte vom Institut für Architektur der Universität Kassel holt ihn aus der Petrischale und setzt ihn auf Hanfspäne – Industrieabfall. Zusammen mit dem Karlsruhe Institut für Technologie und einem Berliner Ingenieursbüro erforschen sie und ihre Kollegen die Eigenschaften von Ganoderma als Baustoff. Nadja Nolte, Universität Kassel „Also hier haben wir den Pilz gerade erst reingefüllt und hier sind die Hanfschäben noch locker im Beutel vorhanden und dann nach ca. einer Woche würde das so aussehen. Einige der Hanfschäben wären schon durch das Myzel miteinander verbunden. Wenn es dann fertig durchwachsen ist, dann sieht man hier schon, sind alle Hanfschäben miteinander verbunden zu einem schon sehr festen Block. Dieses Stadium ist nach ca. zwei bis drei Wochen erreicht.“ Das fertige Material wird dann noch einmal zerkleinert und in ein Holzgerüst eingesetzt. Pilz und Holz verbinden sich so zu stabilen Trennwänden, die darüber hinaus auch noch sehr gute schalldämpfende Eigenschaften aufweisen. Ein absolutes Naturprodukt also, denn selbst bei der Holzkonstruktion kommen die Forscher ohne Klebstoff aus. Die Holzstreben werden mit Ultraschall verbunden. Die Form der Holzrahmen und auch die des Pilzes lassen sich perfekt steuern. Mit ihren Pilz-Wänden hat die Forschungsgruppe Großes vor. Eda Özdemir, Universität Kassel: „Wir wollen alle Büro-Trennwände mit unserem Produkt ersetzen, denn sie haben eine sehr kurze Lebensdauer. Um das zu schaffen müssen wir viel mehr herstellen können und dafür brauchen wir Strategien aus der Massenproduktion.“ Und […]