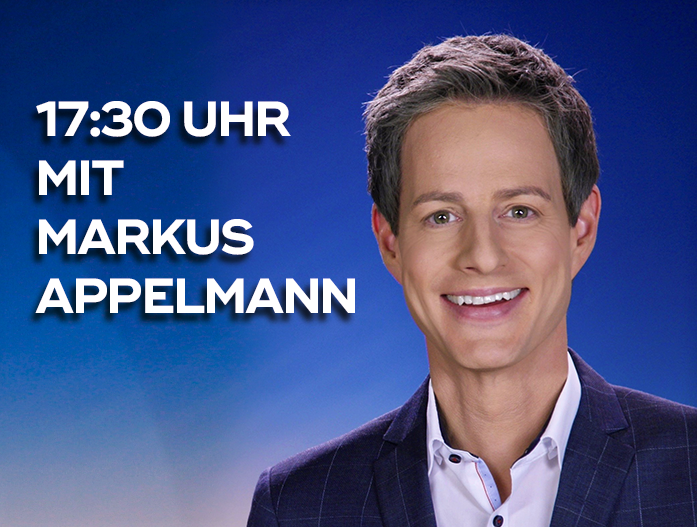Kommentar: „Bald sind die Lokführer unbeliebter als die Bahnvorstände“
Nichts geht mehr – der Bahnstreik und seine Auswirkungen dazu hat unser stellvetretender Chefredakteur Philipp Stelzner eine klare Meinung. Hier ist sein Kommentar. In dem Tarifkonflikt hat die Gewerkschaft der Lokführer einen ziemlich unbeliebten Gegner. Denn seit Jahren ärgern sich die Kunden bei der Bahn über abenteuerliche Verspätungen, geschlossene Bordbistros und wackelige Internetverbindungen. Doch bald könnten die Lokführer noch unbeliebter sein als die Bahnvorstände. Denn ihr Gewerkschaftsführer Claus Weselsky will auf Biegen und Brechen die 35-Stunde-Woche bei vollem Lohnausgleich durchzusetzen. Auch wenn die Fahrkarten dann noch teurer werden. Die Vertreter der Bahn diffamiert Weselsky regelmäßig als „Nieten in Nadelstreifen“. Auch zwei Schlichter sind an seiner Kompromisslosigkeit gescheitert. Jetzt droht er auch noch sogenannte Wellenstreiks an, die nicht mehr vorher angekündigt werden. Damit werden Zugreisen endgültig unberechenbar. Dass Weselsky damit den Ruf der Bahn noch stärker ramponiert, scheint ihm gleichgültig zu sein. Die großen Schäden in der Wirtschaft sind ihm egal. Die Probleme von Millionen Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind, sind ihm schnuppe. Hier will sich offenbar ein Gewerkschaftsführer kurz vor dem Ruhestand ein Denkmal setzen – ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist der Punkt, an dem endlich die Politik eingreifen muss. Niemand will die Tarifautonomie abschaffen, aber das Streikrecht braucht neue Regeln. Es geht hier um die öffentliche Daseinsvorsorge und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wenn die Politiker nichts ändern, werden noch mehr Pendler, Fernreisende und Unternehmer dauerhaft von der Bahn auf Pkw und Lkw umsteigen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die Regierungsparteien und auch die Lokführer eigentlich wollen.