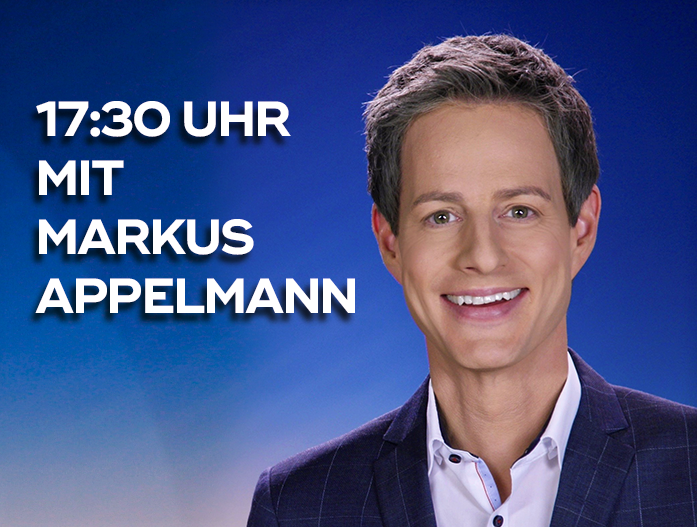Förderprogramm für genug sauberes Trinkwasser
Rhein-Hunsrück, Hochtaunus, Altenkirchen, Cochem-Zell – all diese Landkreise haben eins gemeinsam: Überall dort wurde in der Vergangenheit das Wasser knapp und die Einwohner aufgerufen, Wasser zu sparen. Angesichts der Klimawandels ist jetzt schon klar: Wasser wird Mangelware. Was nun? Land und Kommunen wollen in Rheinland-Pfalz zukünftig gemeinsam eine krisenfeste Versorgung sicherstellen. Durch die Leitungen von Wasserversorger Ronald Roepke in Bodenheim sprudeln jährlich bis zu 15 Millionen Kubikmeter Trinkwasser für 300.000 Menschen. Wenn alles gut läuft. Über Notsituationen wie beispielsweise Stromausfälle, die die Versorgung mit dem Lebensmittel Nummer 1 gefährden könnten, macht er sich schon länger Gedanken. Ronald Roepke, Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen / Rheinland-Pfalz „Neben dem Thema Klimawandel natürlich – wo kommt das Wasser her? – andere Themen wie Cyberkriminalität machen uns auch große Sorgen. Auch da bereiten wir uns vor, natürlich nicht so öffentlich und versuchen die Unternehmen und Infrastruktur deutlich resilienter aufzustellen.“ Die Wasserversorgung widerstandsfähig machen. Dafür besiegeln Wasserwirtschaft, Kommunen und Landesregierung heute mit ihrer Unterschrift einen gemeinsamen Pakt. Das Ziel: Im Notfall sollen mindestens drei Tage lang mindestens 50 Liter sauberes Trinkwasser pro Einwohner aus dem Hahn fließen. Katrin Eder (Bündnis 90/Die Grünen), Klimaschutzministerin Rheinland-Pfalz „Es geht darum, dass wir uns vorbereiten auf Wasserversorgung im Klimawandel. Deshalb nehmen wir 30 Millionen zusätzlich in die Hand um allen Wasserversorgern in Rheinland-Pfalz eine wissenschaftliche Standortbestimmung zu geben, wo stehen sie in einer Krise und daraus dann auch die Maßnahmen finanziell zu unterstützen.“ Mit dem Geld sollen insbesondere Fernleitungen zwischen den einzelnen Wasserversorgern gebaut werden. Regionen mit viel Grundwasser wie beispielsweise der Pfälzerwald können im gemeinsamen Netzwerk dann trockeneren Gegenden wie Rheinhessen aushelfen. Denn in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen fünf Jahren rund ein Viertel weniger Grundwasser neu gebildet. Das Geld vom Land ist für den Wasserversorger ein Anfang. Ronald Roepke, Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen […]